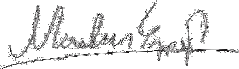Wenn wir heute über Informationssicherheit sprechen, denken wir fast automatisch an digitale Angriffe, Firewalls, Passwörter und Verschlüsselung. Der Begriff wirkt untrennbar mit dem Internet verbunden. Dabei ist Informationssicherheit deutlich älter als die digitale Vernetzung. Sie beginnt nicht mit Computern, sondern mit den ersten Versuchen, Wissen, Daten und strategisch wichtige Fakten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Lange bevor Hacker aus dunklen Kellern und staatliche Cyberoperationen Schlagzeilen machten, mussten Unternehmen, Regierungen und Militärs dafür sorgen, dass Informationen nicht in falsche Hände gerieten. Nur waren die Bedrohungen damals anderer Natur – und die Schutzmaßnahmen sahen ganz anders aus. In einer Welt ohne digitale Kopien existierte jede Information auf einem physischen Medium: handgeschriebene Dokumente, gedruckte Akten, Mikrofilmrollen, Magnetbänder oder sogar in den Köpfen ausgewählter Personen. Wer eine Information stehlen wollte, musste nicht durch eine Firewall, sondern durch eine verschlossene Tür, an einem Pförtner vorbei oder in ein gesichertes Archiv eindringen. Und wer sie schützen wollte, setzte auf Schlösser, Tresore, Wachpersonal und strenge Zugangsprotokolle. Informationssicherheit bedeutete damals, die physische Kontrolle über das Medium zu behalten, auf dem die Information existierte. Diese grundlegende Idee – Kontrolle über das Trägermedium, Kontrolle über die Personen, Kontrolle über die Wege – prägt bis heute jedes moderne Sicherheitskonzept, auch wenn sich die Träger, Personen und Wege massiv verändert haben.
Militärische Kryptographie und staatliche Geheimhaltung
Besonders weit entwickelt war die Informationssicherheit schon früh im militärischen Bereich. Schon im 19. Jahrhundert kannten Armeen die Notwendigkeit, Operationspläne, technische Baupläne oder diplomatische Depeschen vor neugierigen Augen zu verbergen und bei Bedarf zu verschlüsseln. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg wurden ganze Abteilungen damit beauftragt, Nachrichten unlesbar zu machen und gleichzeitig feindliche Chiffren zu knacken. Die berühmte Enigma-Maschine der deutschen Wehrmacht ist nur das bekannteste Beispiel, doch sie steht stellvertretend für ein umfassendes System aus Verschlüsselung, Schlüsselverwaltung, Kurierdiensten, Funkdisziplin, Tarnbegriffen, abgestuften Geheimhaltungsgraden und strenger Sanktionskultur. Die Antwort der Alliierten – die Codeknacker in Bletchley Park um Alan Turing – ist legendär und zeigt zugleich, dass Informationssicherheit nie nur Technik ist. Es geht ebenso um Organisation, Geheimhaltung, disziplinierte Arbeitsteilung, Redundanz und die Fähigkeit, Fehlerquellen im eigenen System zu erkennen und zu korrigieren. In diesem Umfeld entstanden Prinzipien, die später in die Managementsysteme der zivilen Wirtschaft gewandert sind: „Need to know“ statt „nice to have“, Schlüsseltausch nach definierten Intervallen, Vier-Augen-Prinzip bei besonders sensiblen Operationen, die klare Trennung von Rollen und Verantwortlichkeiten sowie eine kompromisslose Dokumentation von Veränderungen an Verfahren und Material.