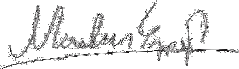„Das Bauchgefühl war bisher gar nicht so schlecht“ – dieser Satz fällt in Vorständen erstaunlich oft, wenn es um Risikoentscheidungen geht. Und ja: Erfahrung, Intuition und Brancheninstinkt sind wertvoll. Aber sie sind nicht reproduzierbar, nicht auditierbar und nicht skalierbar. Spätestens wenn Risiken mit Technologiegeschwindigkeit wachsen, Lieferketten global verästeln, Regulierungen Evidenz verlangen und Budgets knapp sind, kommt die Stunde der Risikoquantifizierung 2.0: ein Set aus Daten, Modellen, Messpunkten, Routinen und Kultur, das Unsicherheit nicht romantisiert, sondern handhabbar macht – ohne den Irrtum zu pflegen, man könne die Zukunft exakt berechnen. Es geht nicht um Zahlenfetisch, sondern um entscheidungsreife Transparenz: So viel Risiko können wir tragen, so schnell müssen wir reagieren, so stark wirken Maßnahmen, so teuer ist Verzögerung. Dieser Beitrag zeigt, wie der Sprung gelingt – von Scorecards und Farbfeldern zu belastbaren Verteilungen und Zeit-Kosten-Profilen; von Einmalstudien zu laufender Beweisführung; von Bauchgefühl zu messbarem Ermessen.
1) Wozu quantifizieren? Vom Schönreden zum Steuern
Die Grundfrage ist banal und radikal zugleich: Wieviel Risiko können wir uns leisten, um unsere Ziele zu erreichen? Die klassische Heatmap beantwortet sie kaum. Sie ordnet ein, färbt ein, schafft Konsens – aber selten Entscheidungen. Risikoquantifizierung 2.0 macht aus Diskussionen Handlungsoptionen: